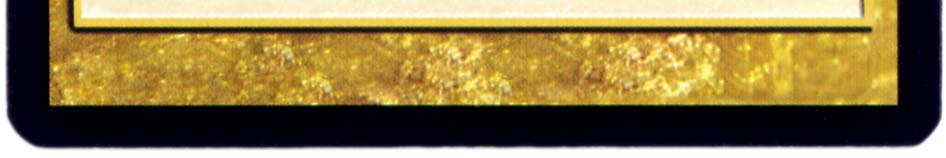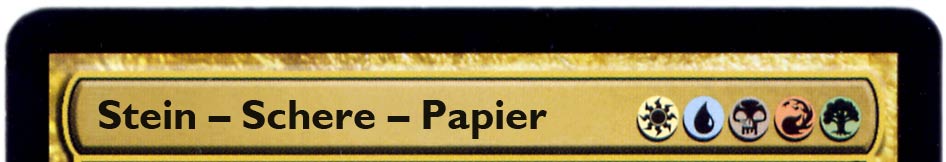


Als jemand, der gerne bunte Karten seitwärts dreht, ist es nicht immer einfach, anderen Leuten, vor allem Menschen, die im Allgemeinen kein besonders ausgeprägten »Spieltrieb« haben, begreiflich zu machen, warum man so viel Zeit in eine vermeintlich unprofitable Beschäftigung steckt.
Meist ist es den Leuten auch ziemlich egal und man kriegt einfach den gleichen mitleidigen Blick, den viele Leute auch für Yu-Gi-Oh-Spieler übrig haben. Aber ab und an will dann doch mal jemand genauer wissen, was einen hoffentlich halbwegs vernunftbegabten Menschen dazu treibt, dem kommerziellen Kartenspiel »Magic: The Gathering« zu frönen. Dies ist »Außenseitern« meist schwer, verständlich zu machen, speziell innerhalb eines zeitlich angemessenen Rahmens, deshalb versuche ich mich hier einmal.

Man muss bei Spielen drei Kategorien unterscheiden: Spiele, die vollständig abhängig (Roulette), teilweise abhängig (Doppelkopf, Skat) und komplett unabhängig (Schach) vom Zufall funktionieren. Magic fällt unter den zweiten Fall und das ist vermutlich auch einer der Gründe für den kommerziellen Erfolg des Spiels. In dieser Form kann es eine breite Masse an Spielerprofilen ansprechen. Während Glückspiele keine spielerischen Anforderungen stellen und deshalb praktisch nur über den Einsatz motivieren, haben Spiele, die keinerlei Zufallsergebnisse liefern, das Problem, dass sie von vielen Leuten als relativ dröge angesehen werden, da man Dank vollständiger Information über alle Spielparameter alles auf mathematische Probleme reduzieren kann. Magic bietet eine ähnliche Spieltiefe wie Schach, um nicht zu sagen eine Höhere, aber man hat bis auf einzelne Spielsituationen nie den perfekten Informationsstand, so dass man nicht sicher sein kann, die volle Kontrolle über das Spielgeschehen zu halten oder zu erhalten. Dies ermöglicht es allen Spielern die eigenen Fähigkeiten möglichst wenig objektiv zu beurteilen, da Anfänger relativ schnell in gewissem Maße Erfolg haben und erfahrenere Spieler Misserfolg auf einen für sie »unglücklichen« Spielverlauf zurückführen können. So suggerieren sich alle, sie wären »gute« Magicspieler und bleiben langfristig am Ball.
Einfach dargestellt basiert das Spiel darauf, sich aus einer irgendwie beschränkten Menge Karten unter »Freizeitspielern« (sog. Casualspieler) meist einfach begrenzt durch die im eigenen Besitz befindlichen, bei Turnierspielern definiert durch das Format, ein sogenanntes »Deck« zusammenzustellen. Selbiges wird dann gegen, in Multiplayerformaten teilweise auch mit, anderen Spieler ausgetestet. Das besondere bei einem kommerziellen Spiel ist hierbei, dass immer wieder neue Editionen und damit Karten auf den Markt gebracht werden (logisch: die Entwickler wollen Geld mit dem Spiel verdienen) und das Spiel sich somit im Vergleich zu vielen anderen, vor allem nichtkommerziellen Spielen entwickelt und damit langfristig das Potential aufweist, ständig weiter zu motivieren. Magic funktioniert dabei, wie viele kommerzielle Strategiespiele, sei es in Kartenform oder eher in digitaler Form, auf dem selben Grundkonzept, der vermeintlich einfachsten Form des Strategiespiels »Stein – Schere – Papier«. Es geht darum, dass A B schlägt, welches seinerseits C ausschaltet, das als einzige Möglichkeit übrigbleibt, gegen A vorzugehen. Sehr vereinfacht dargestellt gilt dies bei Magic für verschiedene Archetypen von Decks ähnlich. So schlagen vermeintlich aggressive Decks, sogenannte Aggrodecks, Kontrolldecks, welche Kombodecks zuverlässig nass machen sollten, die ihrerseits von Aggrodecks (wenig erfolgreich) verflucht werden.
Während das in dieser Grundform eher einem Glücksspiel zu gleichen scheint, bieten komplexere Ausprägungen deutlich mehr Möglichkeiten, sich optimal zu positionieren. So gibt es Leute, die das klassische »Stein – Schere – Papier« um den »Brunnen« erweitern und hier beginnt bereits die erste Form von strategischen Entscheidungen. Nun haben wir eine Spielumgebung, in der nicht alle Möglichkeiten die gleiche »Stärke« besitzen. Der Brunnen schlägt nämlich außer dem Papier alle anderen Möglichkeiten, somit schlagen Papier und Brunnen jeweils zwei der anderen, während Stein und Schere nur eine andere Möglichkeit schlagen. Nun erscheint es logisch, entweder Papier oder Brunnen zu wählen und vermutlich ist es in diesem Beispiel auch tatsächlich die sinnvollste Möglichkeit. Aber das würde bedeuten, dass das Spiel bereits eine Designschwäche aufweist und das sogenannte »Balancing«, das Ausgleichen der Stärke verschiedener Spielmöglichkeiten und -strategien, nicht richtig beachtet wurde. Beim »Balancing« äußert sich vermutlich genau die Stärke eines kommerziellen Spiels wie Magic. Ein sich ständig entwickelndes und in der Grundform bereits komplexes Spiel führt zu einem enormen Entwicklungsaufwand, wenn man verhindern will, dass vor allem beim »Balancing«, als auch bei der Interaktion neuer Karten mit älteren innerhalb der Regeln, Probleme vermieden werden sollen. Das Problem ist also, ähnlich der Entropie in der Physik, dass die steigende Menge der Karten für mehr »Unordnung« sorgt. Den Aufwand diese Entwicklung zu kontrollieren, können im Fall eines kommerziellen Spiels Spezialisten hauptberuflich betreiben und das bedeutet, wir haben trotz inzwischen vieler tausend Karten ein (weitestgehend) funktionierendes Spiel, indem auf Turnierniveau hauptsächlich die Fähigkeiten des Spielers über dessen Erfolg entscheiden.
Aber um noch einmal auf das »Stein – Schere – Papier – Brunnen« - Beispiel zurückzukommen: Dieses ermöglicht auch die erste Form von »Metagame«. Sollte jemand einem anbieten, eine Entscheidung mit Hilfe von »Stein – Schere – Papier« inklusive dem »Brunnen« zu fällen, würde ich als Erstes einmal Verdacht schöpfen, denn spätestens der Brunnen sorgt dafür, dass der Ausgang dieser Entscheidungsfindung nicht mehr zufällig ist und der Gegenüber sich vielleicht bessere Chancen ausrechnet, diese zu seinen Gunsten zu entscheiden. Im zweiten Schritt könnte man nun überlegen, dies für die eigenen Zwecke zu nutzen, weil man vermutet, man würde unterschätzt und sei sich nicht im Klaren darüber, dass der Brunnen und Papier stärker sind.
Dies Form von Überlegungen bezeichnet man bei Magic als »Metagame«, das Spiel hinter dem eigentlichen Spiel, was auf Magic bezogen bedeutet, dass man vor dem Antritt bei einem Turnier versuchen kann, das zu erwartende Feld an Decks einzuschätzen und das eigene Deck entsprechend darauf einzustellen. Dies bedeutet nicht nur, den entsprechenden Archetypen des eigenen Decks richtig zu wählen (Aggro – Control – Combo) sondern auch innerhalb dieses das Deck entsprechend zu »feintunen«.
Die Anforderungen an den Spieler sind bei Magic denkbar vielseitig, was ebenfalls einen großen Teil der Motivation ausmacht. So sind die eigentlichen spielerischen Fähigkeiten, also das optimale Spielverhalten innerhalb der Regeln, nur ein Teil der Fähigkeiten, die einem zu Erfolg verhelfen können. Vermutlich genauso wichtig ist die Fähigkeit, Decks zu kreieren und zu entwickeln. Zwar ist im Zeitalter des Netzes dies für Turniere auf lokalem Niveau nur begrenzt notwendig, da man Decklisten im Netz von professionellen Magicspielern (im weiteren nur Pros genannt) einsehen und kopieren kann, aber zum einen muss man diese wenigstens für das lokale Metagame »tunen« können, zum anderen hilft das spätestens auf großen internationalen Events (Pro Tour, Grand Prix) nur begrenzt, da dort die Pros genau die neusten Kreationen präsentieren. Des weiteren ist das »Metagaming«, sprich die richtige Deckwahl und Tuning sehr hilfreich. Spieler, die alle Fähigkeiten auf gleich hohem Niveau vereinen, sind eher die Ausnahme, da gerade das Deckdesign eine eher kreative Aufgabe ist, während das eigentliche Spielen vor allem kausallogische Fähigkeiten erfordert, so dass bei den Pros oft ein einzelner Deckdesigner auf eine ganze Spielgruppe kommt (so sieht man häufig die Vertreter einer Nation mit den gleichen oder ähnlichen Decks auf der Pro Tour).
Aber alles Gute hat auch seinen Preis (und zwar neben dem monetären). Denn ein teilweise zufallsbasiertes Spiel kommt auch teilweise mit dessen Nebenwirkungen daher.
So ereignete es sich, dass ein guter Freund von mir, der keinen besonderen Bezug zu Glücksspielen hat, eines Tages die Idee hatte, doch einmal ein Casino zu besuchen. Nachdem ein paar Euro in einen Pokerautomaten gewandert waren, fing die Maschine fürchterlich an Krach zu machen. Einige freundliche Mitarbeiter wiesen ihn daraufhin, dass er den Jackpot gewonnen habe. Er erhielt einen vierstelligen Eurobetrag und verließ das Casino. Er erzählte mir, dass die Blicke vieler anderer Spieler beim Verlassen des Casinos seinen sicheren Tod bedeutet hätten, wenn denn Blicke töten könnten.
Magic ist zwar nur teilweise zufallsbasiert und die Fähigkeiten, sowie die Disziplin, eines Spielers sorgen mittel- bis langfristig auch für den entsprechenden Erfolg und das »Glück« nur zu einem kleineren Teil, aber jeder der länger kompetitiv Magic gespielt hat, kennt Tage, an denen scheinen einem die Karten einfach feindlich gesonnen. An solchen Tagen ist es schwer, die eigene Leistung möglichst objektiv zu beurteilen und ich tendiere dazu, eher mehr zu spielen, um mir selbst etwas zu beweisen, mit der Tendenz objektiv schlechter zu spielen. In solchen Fällen ist es in der Regel besser, die Karten beiseite zu legen, aber ich kann in diesen Fällen Züge von Suchtverhalten an mir beobachten. Dementsprechend gibt es Tage, an denen weniger erfahrene (was nicht zwingend untalentierte heißt) recht erfolgreich sind. Trifft ein solcher Tag auf einen, an dem man selbst ohnmächtig dem Spiel zuschaut, ist es schwer, keine Missgunst aufkommen zu lassen. Genau das ist es, was mein Freund an diesem Tag beobachten konnte, die Missgunst derer, die ihre innere Befindlichkeit von Zufallsereignissen abhängig machen.

Ich muss gestehen, dass Magic vermutlich einen besonderen Nerv bei mir getroffen hat, denn viele Leute lässt Magic komplett kalt (auch Leute die ich als affin eingeschätzt hätte) und viele sehen darin »nur« ein weiteres Spiel unter vielen. Aber wer gerne komplexe Spielzüge und Boardsituationen, z.B. beim Schach analysiert, der bekommt bei Magic noch mindestens eine Dimension mehr geboten, der Bedarf für die Antizipation der Möglichkeiten des Gegners ohne diese, in der Regel, sicher bestimmen zu können. Diese Komplexität ist Segen und Fluch zugleich für das Spiel, denn es kann praktisch nur über »Mundpropaganda« wirklich verbreitet werden, denn Mithilfe einer schriftlichen Anleitung lässt sich Magic kaum ordentlich erlernen, es sei denn man steht darauf, sich vor dem eigentlichen Spaß einige Tage mit einem theoretischen Geschwulst von Regeln zu beschäftigen. Des weiteren hat Magic ein wenig ein »Imageproblem«. Die Einstiegszielgruppe die angesprochen werden soll ist jung, vorwiegend männlich und sollte eine Affinität zum Spielen im Allgemeinen haben (unvermeidliche, trotz des Versuches, Assoziation: Nerds). Dementsprechend ist die Vermarktung entsprechend ausgerichtet und Leute, die nicht dieser Zielgruppe entsprechen, müssen schon ein gewisses Maß an Beharrlichkeit mitbringen, um sich durch das komplexe Regelwerk, und an all den Goblins und Elfen vorbei, zur Essenz des Spieles durchzubeißen. Dort angekommen, darf man sich dann vielleicht noch mit den entsprechenden Vorurteilen rumschlagen, die dieser Zielgruppe anhaften und muss, wenn man nicht gerade auf internationalem Topniveau spielt und den Jetset-Lifestyle genießt, auch schon mal mit etwas beengten Platzverhältnissen und YuGiOh-Kiddygekreische als Hintergrundberieselung leben. Kann einen all das nicht abschrecken, hat man mit Magic vermutlich eines der spielerisch komplexesten und am weitesten entwickelten Spiele, die primär keine technischen Hilfsmittel benötigen.
» Weitere Magic-Artikel im ZG-Blog
Meist ist es den Leuten auch ziemlich egal und man kriegt einfach den gleichen mitleidigen Blick, den viele Leute auch für Yu-Gi-Oh-Spieler übrig haben. Aber ab und an will dann doch mal jemand genauer wissen, was einen hoffentlich halbwegs vernunftbegabten Menschen dazu treibt, dem kommerziellen Kartenspiel »Magic: The Gathering« zu frönen. Dies ist »Außenseitern« meist schwer, verständlich zu machen, speziell innerhalb eines zeitlich angemessenen Rahmens, deshalb versuche ich mich hier einmal.
Man muss bei Spielen drei Kategorien unterscheiden: Spiele, die vollständig abhängig (Roulette), teilweise abhängig (Doppelkopf, Skat) und komplett unabhängig (Schach) vom Zufall funktionieren. Magic fällt unter den zweiten Fall und das ist vermutlich auch einer der Gründe für den kommerziellen Erfolg des Spiels. In dieser Form kann es eine breite Masse an Spielerprofilen ansprechen. Während Glückspiele keine spielerischen Anforderungen stellen und deshalb praktisch nur über den Einsatz motivieren, haben Spiele, die keinerlei Zufallsergebnisse liefern, das Problem, dass sie von vielen Leuten als relativ dröge angesehen werden, da man Dank vollständiger Information über alle Spielparameter alles auf mathematische Probleme reduzieren kann. Magic bietet eine ähnliche Spieltiefe wie Schach, um nicht zu sagen eine Höhere, aber man hat bis auf einzelne Spielsituationen nie den perfekten Informationsstand, so dass man nicht sicher sein kann, die volle Kontrolle über das Spielgeschehen zu halten oder zu erhalten. Dies ermöglicht es allen Spielern die eigenen Fähigkeiten möglichst wenig objektiv zu beurteilen, da Anfänger relativ schnell in gewissem Maße Erfolg haben und erfahrenere Spieler Misserfolg auf einen für sie »unglücklichen« Spielverlauf zurückführen können. So suggerieren sich alle, sie wären »gute« Magicspieler und bleiben langfristig am Ball.
Einfach dargestellt basiert das Spiel darauf, sich aus einer irgendwie beschränkten Menge Karten unter »Freizeitspielern« (sog. Casualspieler) meist einfach begrenzt durch die im eigenen Besitz befindlichen, bei Turnierspielern definiert durch das Format, ein sogenanntes »Deck« zusammenzustellen. Selbiges wird dann gegen, in Multiplayerformaten teilweise auch mit, anderen Spieler ausgetestet. Das besondere bei einem kommerziellen Spiel ist hierbei, dass immer wieder neue Editionen und damit Karten auf den Markt gebracht werden (logisch: die Entwickler wollen Geld mit dem Spiel verdienen) und das Spiel sich somit im Vergleich zu vielen anderen, vor allem nichtkommerziellen Spielen entwickelt und damit langfristig das Potential aufweist, ständig weiter zu motivieren. Magic funktioniert dabei, wie viele kommerzielle Strategiespiele, sei es in Kartenform oder eher in digitaler Form, auf dem selben Grundkonzept, der vermeintlich einfachsten Form des Strategiespiels »Stein – Schere – Papier«. Es geht darum, dass A B schlägt, welches seinerseits C ausschaltet, das als einzige Möglichkeit übrigbleibt, gegen A vorzugehen. Sehr vereinfacht dargestellt gilt dies bei Magic für verschiedene Archetypen von Decks ähnlich. So schlagen vermeintlich aggressive Decks, sogenannte Aggrodecks, Kontrolldecks, welche Kombodecks zuverlässig nass machen sollten, die ihrerseits von Aggrodecks (wenig erfolgreich) verflucht werden.
Während das in dieser Grundform eher einem Glücksspiel zu gleichen scheint, bieten komplexere Ausprägungen deutlich mehr Möglichkeiten, sich optimal zu positionieren. So gibt es Leute, die das klassische »Stein – Schere – Papier« um den »Brunnen« erweitern und hier beginnt bereits die erste Form von strategischen Entscheidungen. Nun haben wir eine Spielumgebung, in der nicht alle Möglichkeiten die gleiche »Stärke« besitzen. Der Brunnen schlägt nämlich außer dem Papier alle anderen Möglichkeiten, somit schlagen Papier und Brunnen jeweils zwei der anderen, während Stein und Schere nur eine andere Möglichkeit schlagen. Nun erscheint es logisch, entweder Papier oder Brunnen zu wählen und vermutlich ist es in diesem Beispiel auch tatsächlich die sinnvollste Möglichkeit. Aber das würde bedeuten, dass das Spiel bereits eine Designschwäche aufweist und das sogenannte »Balancing«, das Ausgleichen der Stärke verschiedener Spielmöglichkeiten und -strategien, nicht richtig beachtet wurde. Beim »Balancing« äußert sich vermutlich genau die Stärke eines kommerziellen Spiels wie Magic. Ein sich ständig entwickelndes und in der Grundform bereits komplexes Spiel führt zu einem enormen Entwicklungsaufwand, wenn man verhindern will, dass vor allem beim »Balancing«, als auch bei der Interaktion neuer Karten mit älteren innerhalb der Regeln, Probleme vermieden werden sollen. Das Problem ist also, ähnlich der Entropie in der Physik, dass die steigende Menge der Karten für mehr »Unordnung« sorgt. Den Aufwand diese Entwicklung zu kontrollieren, können im Fall eines kommerziellen Spiels Spezialisten hauptberuflich betreiben und das bedeutet, wir haben trotz inzwischen vieler tausend Karten ein (weitestgehend) funktionierendes Spiel, indem auf Turnierniveau hauptsächlich die Fähigkeiten des Spielers über dessen Erfolg entscheiden.
Aber um noch einmal auf das »Stein – Schere – Papier – Brunnen« - Beispiel zurückzukommen: Dieses ermöglicht auch die erste Form von »Metagame«. Sollte jemand einem anbieten, eine Entscheidung mit Hilfe von »Stein – Schere – Papier« inklusive dem »Brunnen« zu fällen, würde ich als Erstes einmal Verdacht schöpfen, denn spätestens der Brunnen sorgt dafür, dass der Ausgang dieser Entscheidungsfindung nicht mehr zufällig ist und der Gegenüber sich vielleicht bessere Chancen ausrechnet, diese zu seinen Gunsten zu entscheiden. Im zweiten Schritt könnte man nun überlegen, dies für die eigenen Zwecke zu nutzen, weil man vermutet, man würde unterschätzt und sei sich nicht im Klaren darüber, dass der Brunnen und Papier stärker sind.
Dies Form von Überlegungen bezeichnet man bei Magic als »Metagame«, das Spiel hinter dem eigentlichen Spiel, was auf Magic bezogen bedeutet, dass man vor dem Antritt bei einem Turnier versuchen kann, das zu erwartende Feld an Decks einzuschätzen und das eigene Deck entsprechend darauf einzustellen. Dies bedeutet nicht nur, den entsprechenden Archetypen des eigenen Decks richtig zu wählen (Aggro – Control – Combo) sondern auch innerhalb dieses das Deck entsprechend zu »feintunen«.
Die Anforderungen an den Spieler sind bei Magic denkbar vielseitig, was ebenfalls einen großen Teil der Motivation ausmacht. So sind die eigentlichen spielerischen Fähigkeiten, also das optimale Spielverhalten innerhalb der Regeln, nur ein Teil der Fähigkeiten, die einem zu Erfolg verhelfen können. Vermutlich genauso wichtig ist die Fähigkeit, Decks zu kreieren und zu entwickeln. Zwar ist im Zeitalter des Netzes dies für Turniere auf lokalem Niveau nur begrenzt notwendig, da man Decklisten im Netz von professionellen Magicspielern (im weiteren nur Pros genannt) einsehen und kopieren kann, aber zum einen muss man diese wenigstens für das lokale Metagame »tunen« können, zum anderen hilft das spätestens auf großen internationalen Events (Pro Tour, Grand Prix) nur begrenzt, da dort die Pros genau die neusten Kreationen präsentieren. Des weiteren ist das »Metagaming«, sprich die richtige Deckwahl und Tuning sehr hilfreich. Spieler, die alle Fähigkeiten auf gleich hohem Niveau vereinen, sind eher die Ausnahme, da gerade das Deckdesign eine eher kreative Aufgabe ist, während das eigentliche Spielen vor allem kausallogische Fähigkeiten erfordert, so dass bei den Pros oft ein einzelner Deckdesigner auf eine ganze Spielgruppe kommt (so sieht man häufig die Vertreter einer Nation mit den gleichen oder ähnlichen Decks auf der Pro Tour).
Aber alles Gute hat auch seinen Preis (und zwar neben dem monetären). Denn ein teilweise zufallsbasiertes Spiel kommt auch teilweise mit dessen Nebenwirkungen daher.
So ereignete es sich, dass ein guter Freund von mir, der keinen besonderen Bezug zu Glücksspielen hat, eines Tages die Idee hatte, doch einmal ein Casino zu besuchen. Nachdem ein paar Euro in einen Pokerautomaten gewandert waren, fing die Maschine fürchterlich an Krach zu machen. Einige freundliche Mitarbeiter wiesen ihn daraufhin, dass er den Jackpot gewonnen habe. Er erhielt einen vierstelligen Eurobetrag und verließ das Casino. Er erzählte mir, dass die Blicke vieler anderer Spieler beim Verlassen des Casinos seinen sicheren Tod bedeutet hätten, wenn denn Blicke töten könnten.
Magic ist zwar nur teilweise zufallsbasiert und die Fähigkeiten, sowie die Disziplin, eines Spielers sorgen mittel- bis langfristig auch für den entsprechenden Erfolg und das »Glück« nur zu einem kleineren Teil, aber jeder der länger kompetitiv Magic gespielt hat, kennt Tage, an denen scheinen einem die Karten einfach feindlich gesonnen. An solchen Tagen ist es schwer, die eigene Leistung möglichst objektiv zu beurteilen und ich tendiere dazu, eher mehr zu spielen, um mir selbst etwas zu beweisen, mit der Tendenz objektiv schlechter zu spielen. In solchen Fällen ist es in der Regel besser, die Karten beiseite zu legen, aber ich kann in diesen Fällen Züge von Suchtverhalten an mir beobachten. Dementsprechend gibt es Tage, an denen weniger erfahrene (was nicht zwingend untalentierte heißt) recht erfolgreich sind. Trifft ein solcher Tag auf einen, an dem man selbst ohnmächtig dem Spiel zuschaut, ist es schwer, keine Missgunst aufkommen zu lassen. Genau das ist es, was mein Freund an diesem Tag beobachten konnte, die Missgunst derer, die ihre innere Befindlichkeit von Zufallsereignissen abhängig machen.
Ich muss gestehen, dass Magic vermutlich einen besonderen Nerv bei mir getroffen hat, denn viele Leute lässt Magic komplett kalt (auch Leute die ich als affin eingeschätzt hätte) und viele sehen darin »nur« ein weiteres Spiel unter vielen. Aber wer gerne komplexe Spielzüge und Boardsituationen, z.B. beim Schach analysiert, der bekommt bei Magic noch mindestens eine Dimension mehr geboten, der Bedarf für die Antizipation der Möglichkeiten des Gegners ohne diese, in der Regel, sicher bestimmen zu können. Diese Komplexität ist Segen und Fluch zugleich für das Spiel, denn es kann praktisch nur über »Mundpropaganda« wirklich verbreitet werden, denn Mithilfe einer schriftlichen Anleitung lässt sich Magic kaum ordentlich erlernen, es sei denn man steht darauf, sich vor dem eigentlichen Spaß einige Tage mit einem theoretischen Geschwulst von Regeln zu beschäftigen. Des weiteren hat Magic ein wenig ein »Imageproblem«. Die Einstiegszielgruppe die angesprochen werden soll ist jung, vorwiegend männlich und sollte eine Affinität zum Spielen im Allgemeinen haben (unvermeidliche, trotz des Versuches, Assoziation: Nerds). Dementsprechend ist die Vermarktung entsprechend ausgerichtet und Leute, die nicht dieser Zielgruppe entsprechen, müssen schon ein gewisses Maß an Beharrlichkeit mitbringen, um sich durch das komplexe Regelwerk, und an all den Goblins und Elfen vorbei, zur Essenz des Spieles durchzubeißen. Dort angekommen, darf man sich dann vielleicht noch mit den entsprechenden Vorurteilen rumschlagen, die dieser Zielgruppe anhaften und muss, wenn man nicht gerade auf internationalem Topniveau spielt und den Jetset-Lifestyle genießt, auch schon mal mit etwas beengten Platzverhältnissen und YuGiOh-Kiddygekreische als Hintergrundberieselung leben. Kann einen all das nicht abschrecken, hat man mit Magic vermutlich eines der spielerisch komplexesten und am weitesten entwickelten Spiele, die primär keine technischen Hilfsmittel benötigen.
» Weitere Magic-Artikel im ZG-Blog